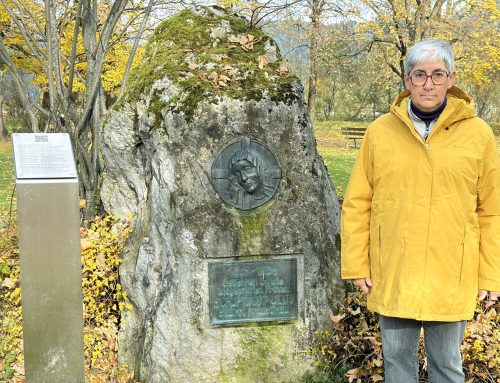Über einen ideenreichen, kaum entbehrlichen Dienstleister für die Bürger der Region – und dabei einen erstaunlich geruchsneutralen
Wo geht deine Reise hin?“, denkt Mia morgens beim Blick in die WC-Schüssel, während sie auf dem stillen Örtchen sitzt. Die 11-Jährige erinnert sich spontan an den Weg von „Nemo“ ins offene Meer, betätigt die Klospülung und beschließt, mehr herauszufinden. Nachdem sie die Hände gewaschen und die WC-Tür geschlossen hat, wird es dahinter still, nur die Spülung rauscht noch kurz. In ihrem Zimmer angekommen, beginnt Mia erleichtert zu recherchieren.
Vom Dunkel ins Licht
Nachdem das Abwasser von der Kloschüssel in die Kanalisation eingeleitet worden ist, erreicht es das nächstgelegene Klärwerk. Beim Eintritt ins Klärwerk sorgt ein großer Rechen dafür, dass die festen Bestandteile wie Essensreste, Hygieneprodukte, Feuchttücher, die nicht ins WC ge-hören, dem Wasser entzogen werden. Danach wird das Abwasser in großen Becken aufbereitet. Der Klärschlamm, der durch den Reinigungsprozess entsteht, wird im Faulturm gesammelt. Durch das Mitwirken von speziellen Bakterien wird Methangas produziert, das zur Eigenstrom-produktion verwendet wird. Das restliche Abwasser wird in Becken geleitet, in denen Millionen unbezahlter fleißiger Bakterien dafür sorgen, dass das Abwasser wieder in die Flüsse in der Nähe von Kläranlagen eingeleitet werden kann. In der letzten Reinigungsstufe ist das Wasser in den Nachklärbecken wieder beinahe zur Gänze geklärt, allerdings noch nicht gereinigt von Medikamentenrückständen und Hormonen.
So weit in der Theorie, denkt Mia, aber was passiert genau in meiner Heimatregion mit unserem Abwasser? Gibt es weitere Ideen?
Vor Ort beim Klärwerk Zukunft
Das Abwasser aus den Gemeinden St. Johann in Tirol, Oberndorf, Kirchdorf und Erpfendorf wird in das gemeinsame Klärwerk geleitet – übrigens eine der fortschrittlichsten Anlagen tirolweit. Und damit auch die Abwässer aus Mias Mehrfamilienhaus.
Unter der Leitung von Geschäftsführer Johann Seiwald arbeiten sechs Mitarbeiter daran, das Schmutzwasser aufzubereiten. Dabei ist das Klärwerk Erpfendorf auf eine Bevölkerungsgröße von 70.000 Personen ausgelegt – weitaus mehr Kapazität, als alle Einwohner zusammengezählt benötigen. Zusätzlich zu den Abwässern von 17.000 Einwohnern wird jedoch auch Abwasser aus Industrie, Krankenhaus, Hotellerie und Gewerbe geklärt.
In der Summe misst das Klärwerk Erpfendorf eine Reinigungsleistung von 99 Prozent. Das letzte verbleibende Prozent sind nicht klärbare Medikamente, Hormone etc. – es verbleibt im Wasser und wird, soweit möglich, von der Natur gefiltert bzw. ausgedünnt. Zukünftig wird für das letzte Prozent eine zusätzliche Klärstufe eingesetzt werden – dafür wird aktuell in Deutschland, Ös-terreich und der Schweiz geforscht. Zusammengerechnet sind im Jahr 2024 2,6 Millionen Ku-bikmeter Wasser geklärt worden – eine Auslastung von 66 Prozent. Aus dem gewonnenen Methangas wird wie in einer Biogasanlage Strom erzeugt und zwar so viel, dass die Kläranlage seit 2015 energieautark ist und 1.120 Kilowattstunden im Jahr 2024 produziert worden sind.
Aus Brokkoli mach Energie
Neben den üblichen Tätigkeiten einer Kläranlage werden in Erpfendorf Speisereste aufbereitet. Nicht nur aus den Verbandsgemeinden, sondern aus dem ganzen Bezirk werden Speisereste angeliefert. Zurück bleibt ein „Substrat“, das in die Faultürme eingebracht und zur Stromerzeu-gung genutzt wird. Jede Gemeinde, die über die nötige Infrastruktur verfügt, kann es abholen und für die eigene Stromproduktion nutzen
– ein Zusatznutzen für alle!
Im Zentrum steht heute das Verursacherprinzip
Vor einigen Jahren führten die Verantwortlichen den „Indirekteinleiterkataster“ ein – ein Verzeichnis aller Betriebe, die das Wasser mehr als haushaltsüblich verschmutzen. Darin wird vertraglich vereinbart, welche Vorleistungen (z. B. durch Fett- oder Mineralölabscheider) die Betriebe am Abwasser vornehmen müssen, bevor es in den Kanal eingeleitet werden kann. Die Abwässer der Betriebe werden kontrolliert – und sollten gesetzliche Grenzwerte nicht eingehalten werden, muss das verursachende Unternehmen für die Mehrkosten aufkommen.
Vor der Einführung dieses Katasters musste die Allgemeinheit, also auch Mias Familie, die Mehrkosten tragen. Der Gedanke dahinter ist Prinzip: Die Bürger sollen nicht mit Kosten belastet werden, die durch Unternehmen verursacht worden sind.
Kanalkataster – Fremdwasser raus!
In den zur Kläranlage gelangenden Abwässern waren früher ca. 40 Prozent Fremdwasser (Regenwasser bzw. sauberes Wasser) enthalten. Verantwortlich für das Fremdwasser waren unter anderem Beschädigungen in den Abwasserkanälen. Daraus ergab sich eine vermeidbare, zu hohe Auslastung der Kläranlage. Dementsprechend wären Investitionen für ein weiteres Klärbecken nötig gewesen. Anstatt diesen Vorschlag zu forcieren, setzte das Team des Klärwerks nicht am Symptom, sondern am Ursprung an. In den Verbandsgemeinden warten nun ausgebil-dete Kanalfacharbeiter die Kanäle – „Fremdwasser“ ist mittlerweile ein Fremdwort. So konnte die Auslastung der Kläranlage massiv gesenkt werden.
Klärschlammtrocknung – ein wahres Sparwunder
Aber das ist noch nicht das Ende der Innovationskraft. Seit 2024 wird der Klärschlamm getrocknet. In der Vergangenheit hatte der entwässerte Klärschlamm, der gegen hohe Kosten Entsor-gungsbetrieben zugeführt wurde, einen Trockengehalt von 25 Prozent. Aufgrund der hohen Feuchtigkeit war die Verbrennung sehr aufwendig. Durch die Installation einer Niedrigtemperaturtrocknung für den Klärschlamm – übrigens der ersten in ganz Tirol –, konnte der Trockengehalt auf 90 Prozent gesteigert werden. Das wiederum senkt die Kosten für die Entsorgung um fast 200.000 Euro pro Jahr – Geld, das nun für wichtige Investitionen zur Verfügung steht.
Wasser ist ein kostbarer Schatz für alle
Mia lehnt sich zurück, sie weiß jetzt fast alles über den Weg des Abwassers in ihrer Region und kann sorgenfrei die Klospülung drücken. Und dennoch ist ihr bewusst, wie wichtig ein gewissenhafter Umgang mit dem Lebensspender Wasser ist.
Was sie bei ihren Nachforschungen noch herausgefunden hat: Jeder vierte Mensch weltweit lebt ohne Zugang zu Toiletten und Wasser – mit hohen gesundheitlichen Risiken. Das macht Mia nachdenklich. Und gerade deswegen ist sie dankbar, frisches Wasser und ein WC zu haben.
Übrigens: Der internationale Welttoilettentag ist am 19. November 2025.
Theresa Hager